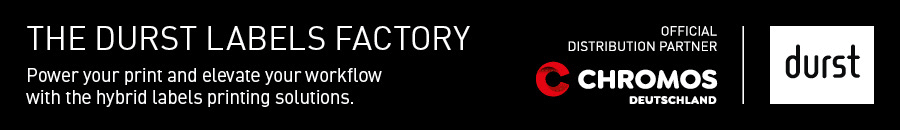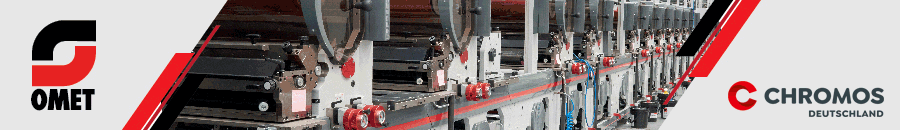Marcus Gablowski
Wenn es um Etiketten für Lebensmittel geht, ist die Unbedenklichkeit des Haftklebstoffs ein äußerst wichtiges Kriterium. Doch was heißt das: »unbedenklich«? Immer wieder wird dazu auf Empfehlungen oder Zulassungen von namhaften Institutionen oder Instituten verwiesen wie BfR, ISEGA oder FDA. Wie unterscheiden diese sich in ihrer Herangehensweise? Was bedeutet eine entsprechende Freigabe? Der folgende Beitrag gibt einen kurzen Überblick.
Die Diskussion um Migration zieht immer weitere Kreise. Gerade Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie sind extrem nervös. Das ist verständlich, denn Rückrufaktionen oder ähnliches sind für die Branche angesichts äußerst sensibler Verbraucher ein heikles Thema. Im Hinblick auf Etiketten betrifft die Diskussion zunächst vor allem die eingesetzten Druckfarben, da hier tatsächlich Handlungsbedarf besteht. Bei Haftklebstoffen ist die Situation etwas anders. Für Lebensmittel freigegebene Haftklebstoffe dürfen per se keine gesundheitsgefährdenden Substanzen enthalten. Doch aufgrund verschiedener physikalischer Prozesse können auch hier Substanzen oder Moleküle herausgelöst werden und selbst durch eine Verpackung hindurch in das Lebensmittel migrieren, erst recht wenn fetthaltige Lebensmittel im Spiel sind. Auch wenn die einzelnen Substanzen keine Gefahr für die Gesundheit darstellen: Niemand möchte gerne etwas in Lebensmitteln haben, was dort nicht hineingehört, schon gar nicht in Mengen, die eigentlich vermeidbar wären. Worauf sollte der Etikettendrucker deshalb achten?

Größtmögliche Sicherheit beim Haftmaterial geben immer bestimmte Zertifikate und Zulassungen, die auf realen Migrationsmessungen beruhen. Damit ist gewährleistet, dass zum einen keine bedenklichen Inhaltsstoffe aus dem Haftklebstoff austreten können und dass zum anderen die Gesamtmenge – auch an unbedenklichen (Inhalts-)Stoffen – nur minimal ist. Wichtig ist: Zulassungen, die sich lediglich auf den Ausschluss von bedenklichen Substanzen beziehen, geben keine Anhaltspunkte dafür, wie viel von den »unbedenklichen« Stoffen migrieren dürfen und können.
Verbindliches Regelwerk
In der Europäischen Union hat die Rahmenverordnung (EU) Nr. 1935/2004 über »Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen« allgemeine Gültigkeit. Diese Rahmenverordnung gilt für alle Materialien und Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen oder dafür vorgesehen sind. Das heißt, Haftmaterial und Etiketten unterliegen in erster Linie dieser Verordnung. Das Regelwerk ist in allen Teilen verbindlich, gilt unmittelbar und in jedem Mitgliedsstaat. Artikel 3 dieser Verordnung fordert allgemein, dass durch Materialien und Gegenstände (hier Verpackungsmaterial) die menschliche Gesundheit nicht gefährdet werden darf, keine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung der Lebensmittel sowie keine Beeinträchtigung z.B. der geruchlichen und geschmacklichen Eigenschaften der Lebensmittel herbeigeführt werden dürfen. Weil diese Regelung etwas schwammig ist, hat die EU am 1. Mai 2011 innerhalb der oben genannten Rahmenverordnung die Verordnung Nr. 10/2011 in Kraft gesetzt. Die Verordnung 10/2011 wird häufig auch als »Kunststoff- Verordnung« bezeichnet. Sie regelt zwar explizit nur den Umgang mit Kunststoffen. Haftklebstoffe werden aber in der Europäischen Union üblicherweise in Anlehnung an die für Kunststoffe geltende Verordnung EU 10/2011 behandelt.

Das Gute an dieser Verordnung: Sie enthält nicht nur eine vollständige Positivliste für Stoffe, die zur Herstellung von Kunststoffen (und im weiteren Sinne von Haftmaterial und Haftklebstoff) eingesetzt werden dürfen. Sondern sie benennt auch Anforderungen an Gesamtmigrationswerte und darüber hinaus spezifische Migrationswerte, die das jeweilige Produkt – in diesem Fall Haftklebstoff oder Haftmaterial – einhalten muss. Die Verordnung und die Grenzwerte werden regelmäßig überarbeitet und angepasst. Zuletzt geschah das im Februar 2015 mit der Richtlinie EU 2015/174.
Festzuhalten ist also: Für Kunststoffe, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, gilt:
- Es dürfen nur Substanzen eingesetzt werden, die auf der genannten Positivliste der EU stehen.
- Die in der EU Verordnung genannte zulässige Gesamtmigration darf nicht überschritten werden.
- Spezifische Migrationswerte (SML) für einzelne Substanzen dürfen ebenfalls nicht überschritten werden.
Unabhängige Prüfinstitute
Als Etikettendrucker könnte man jetzt sagen: Dann wäre es doch am einfachsten, wenn mir mein Haftmateriallieferant sagt: »Das Haftmaterial XY entspricht der Direktive EU 10/2011«. Leider ist das aus zwei Gründen nicht praktikabel. Zum einen handelt es sich bei dem Haftmaterial nicht zwingend um einen Folienverbund. Die als »Kunststoff-Verordnung« bezeichnete Richtlinie behandelt aber – streng genommen – nur Materialien aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen. Papieretiketten würden also herausfallen. Zum anderen würde der alleinige Bezug auf diese Richtlinie eine extreme Vielfalt an Zertifikaten bedeuten. Denn geprüft werden müsste dann jedes Etikettenmaterial in Kombination mit jedem Klebstoff und wiederum bei jedem Klebstoffauftragsgewicht.
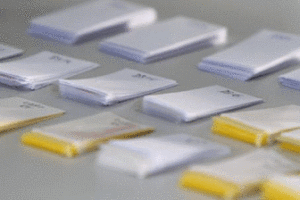
Deshalb treten hier unabhängige Prüfinstitute auf den Plan, wie zum Beispiel die ISEGA. Sie ist wahrscheinlich für Haftmaterial im Etikettenbereich das am häufigsten anzutreffende Institut; es genießt europaweit (und darüber hinaus) Anerkennung. Ein anderes namhaftes Institut in diesem Bereich ist etwa die Fabes Forschungs-GmbH; weitere Prüfgesellschaften listet das FINAT Handbuch auf. Diese Prüfinstitute kontrollieren das tatsächliche Material auf die Abwesenheit von gesundheitlich bedenklichen Stoffen, prüfen und bewerten das Migrationsverhalten und überprüfen die Grenzwerte limitierter Stoffe. Das heißt, die akkreditierten Prüfinstitute prüfen entsprechend der jeweiligen Verordnungen bzw. in Anlehnung an diese:
- die Einhaltung der Gesetzgebung bezüglich Zusatzstoffen, Monomeren und Ausgangsstoffen;
- die Einhaltung der Gesamtmigration des zu prüfenden Gegenstandes;
- die spezifischen Migrationswerte.
Eine Freigabe durch die ISEGA oder ein anderes Prüfinstitut bedeutet also, dass ein bestimmtes Material die EU-Richtlinie einhält und für Lebensmittel eingesetzt werden darf. Dabei kann das Prüfinstitut durchaus Einschränkungen vornehmen. Ein Haftmaterial kann zum Beispiel nur für den indirekten, nicht jedoch für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen sein. Wichtig ist auch der Hinweis, für welche Art von Lebensmitteln das Haftmaterial geeignet ist, für trockene, feuchte oder sogar für fettende Lebensmittel. Sollte letzteres der Fall sein, spielt der Korrekturfaktor eine wichtige Rolle. Er gibt im Grunde an, wie migrationsarm ein bestimmtes Haftmaterial ist (siehe untenstehende Zusatzinfo »Korrekturfaktor – was ist das?«). Das heißt je besser die Freigabe für den direkten Lebensmittelkontakt und je geringer der zugewiesene Korrekturfaktor desto geringer ist das Risiko (und die Menge) migrierender Substanzen.
Als Zwischenfazit kann man festhalten: Wichtig bei der Beurteilung, ob ein Haftmaterial für Lebensmittel geeignet ist, ist die Frage, ob es konform ist zu den genannten EU-Verordnungen. Der alleinige Verweis darauf ist jedoch wenig aussagekräftig. Erst die Freigabe durch ein anerkanntes Prüfinstitut gibt die Gewissheit, dass die Vorgaben durch die EU-Verordnungen auch tatsächlich eingehalten werden.
Positivlisten für weitere Stoffklassen
Warum taucht dann bei vielen Haftmaterialien für den Lebensmittelbereich zusätzlich zur Freigabe durch ein Prüfinstitut noch ein Verweis auf das deutsche Bundesamt für Risikobewertung (BfR) bzw. auf die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) auf? Der Verweis auf das BfR hat damit zu tun, dass sich die »Kunststoff- Verordnung« eben nicht explizit mit Haftklebstoffen, Haftmaterial und Etiketten befasst. Das BfR gibt »Empfehlungen zu Materialien für den Lebensmittelkontakt« heraus. Diese sind »tagesaktuell« und entsprechen dem Stand von Wissenschaft und Technik. Dort werden ausschließlich Stoffklassen behandelt, die nicht in der EU- Verordnung berücksichtigt werden, die aber essentiell sind. Dazu gehören zum Beispiel Emulgatoren für Dispersionen. In den BfR-Listen sind unbedenkliche Stoffe für diese Klassen aufgeführt. Es handelt sich um materialspezifische Positivlisten (durch die einzelnen Empfehlungen z.B. BfR XIV für Dispersionen) für Stoffe, die zur Herstellung benötigt werden. Diese Listen werden häufig allgemein anerkannt, auch von anderen europäischen Ländern, sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Erst ein Verweis auf die BfR-Konformität gibt – gemäß dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik – Sicherheit in Bezug auf den Einsatz des Haftmaterials bei Lebensmitteln.
Etwas anders verhält es sich nach unserer Einschätzung mit dem Verweis auf FDA § 175.105. Darin werden unseres Wissens nach z. B. noch Stoffe zugelassen, die in der EU schon längst verboten sind. Außerdem bezieht sich FDA § 175.105 lediglich auf Stoffe für den Einsatz im indirekten Lebensmittelkontakt. Da Verpackungsmaterialien aller Art nur in den seltensten Fällen eine Barriere darstellen, ist die Aussagekraft ohnehin sehr eingeschränkt.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die EU macht in Form der Verordnung EU 10/2011 bestimmte Vorgaben zu Grenzwerten bezüglich (Kunststoff-) Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Diese Verordnung wird sinngemäß auch für Haftklebstoffe angewandt. Institute wie die ISEGA prüfen, ob ein tatsächlich eingesetztes Material diesen Bestimmungen und ggf. weiteren Empfehlungen bzw. nationalen Bestimmungen entspricht. Das BfR gibt ergänzend dazu nicht- rechtsverbindliche Einschätzungen zu Stoffen, die in der Verordnung EU 10/2011 bzw. der jeweiligen Verordnung/Einzelmaßnahme nicht erfasst sind. Nur dadurch wird eine Einschätzung für z.B. Haftklebstoffdispersionen möglich. Der Hinweis auf FDA § 175.105 hat nach unserer Einschätzung im Grunde keine große Bedeutung, da er sich nur auf indirekten Lebensmittelkontakt bezieht. (Fotos: HERMA)
Zusatzinfo

Korrekturfaktor – was ist das?
Für Haftklebestoffe, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden, gibt es die Korrekturfaktoren von 2 bis 5. Ein Korrekturfaktor 2 bedeutet beispielsweise, dass bei Untersuchungen im Labor mit einem Prüfstoff, einem sogenannten Lebensmittelsimulans, doppelt so viele Bestandteile aus dem Haftkleber herausgelöst werden, wie es bei einem echten Lebensmittel mit 50% Fett der Fall ist. In der Summe dürfen es bei Korrekturfaktor 2 höchstens bis zu 24 mg/dm² sein. Ein Korrekturfaktor von 3 bedeutet, dass bis zu 36 mg/dm² Stoffe herausgelöst werden können, bei einem Korrekturfaktor von 4 sind es bis zu 48 mg/dm². Bei mehr als 60 mg/dm² ist der direkte Kontakt zu fettigen Lebensmitteln nicht mehr zugelassen. Damit man diesen oberen Schwellenwert besser einschätzen kann: Bei Standard-Dispersionshaftklebern liegt der übliche Wert für Migration bereits bei über 70 mg/dm², bei einem typischen Schmelzhaftkleber sind es sogar mehr als 100 mg/dm². Beide können also für den direkten Kontakt zu fettigen Lebensmitteln per se nicht zugelassen werden.
Ausweg aus dem Dilemma
Um einen Haftkleber migrationsärmer zu machen, kann man in einem bestimmten Umfang den Anteil der Zusatzstoffe und Additive reduzieren. Dann verlieren die Klebstoffe jedoch einen Teil ihrer Eigenschaften wie Haftkraft oder Beständigkeiten. Gerade im sensiblen Lebensmittelbereich wird das nicht gerne gesehen. Doch wie lassen sich die Haftungseigenschaften unabhängig von den Migrationseigenschaften steuern? Bei HERMA haben wir dafür eine Mehrschichttechnologie entwickelt. Sie erlaubt es, zwei unterschiedliche Klebstoffschichten gleichzeitig aufzubringen, und zwar zwei unterschiedliche Schichten, die sich nicht vermischen, sondern stabil erhalten bleiben – auch wenn das Haftmaterial bzw. das Etikett über einen langen Zeitraum lagert oder sehr hohem Druck ausgesetzt ist (wie zum Beispiel auf einer Rolle). Jeder Schicht lässt sich eine spezielle Funktion zuweisen. So gelingt es, den Widerspruch aufzulösen zwischen zwei Eigenschaften, die sich bislang ausgeschlossen haben – zum Beispiel ein gutes Migrationsverhalten und gute Haftungseigenschaften. Inzwischen wurde fast das ganze Haftmaterial-Sortiment auf die Mehrschichttechnologie umgestellt. Denn die Vorteile sind groß, die Nachteile nicht vorhanden.
Mehrwert ohne Mehrkosten
Wohlgemerkt: Es handelt sich nicht um neuartige, teure Spezialhaftklebstoffe. Zum Einsatz kommen bei HERMA bestens bewährte Standard-Haftklebstoffe, die sich durch gute Hafteigenschaften auszeichnen und sehr unkompliziert in der Weiterverarbeitung sind. Sie liefern einen Mehrwert ohne Mehrkosten, nämlich zum Beispiel die geringe Migration. Der Unterschied zu einer einschichtig produzierten Variante ist enorm. Der HERMA Haftklebstoff 62G, ein Standardprodukte für ein sehr breites Anwendungsfeld, enthielt früher 50 Milligramm an migrierfähigen Bestandteilen pro Quadratdezimeter. In der Mehrschichtvariante mit der Bezeichnung 62Gpt sind es nur noch 24 Milligramm. Statt Korrekturfaktor 5 erreicht der Haftklebstoff jetzt Korrekturfaktor 2 – ein gewaltiger Unterschied. Das ist kein Einzelfall, sondern entspricht in seiner Tendenz nahezu allen bei HERMA eingesetzten Dispersionshaftklebstoffen. Ob universelle Anwendungen, ob kühl- feuchte Anwendungen oder ob speziell für Folienetiketten – HERMA Haftklebstoffe sind nun durch die Bank migrationsarm.
Über den Autor
 Marcus Gablowski leitet bei HERMA die Entwicklung der Haftklebstoffe und Silikone. Er hat an der Hochschule Esslingen Chemieingenieurwesen studiert und ist seit 2004 bei HERMA vor allem in den Bereichen Verfahrenstechnik und Entwicklung tätig. Dort hat er in den letzten Jahren die Einführung der innovativen Mehrschichttechnologie entscheidend mit begleitet und vorangetrieben.
Marcus Gablowski leitet bei HERMA die Entwicklung der Haftklebstoffe und Silikone. Er hat an der Hochschule Esslingen Chemieingenieurwesen studiert und ist seit 2004 bei HERMA vor allem in den Bereichen Verfahrenstechnik und Entwicklung tätig. Dort hat er in den letzten Jahren die Einführung der innovativen Mehrschichttechnologie entscheidend mit begleitet und vorangetrieben.